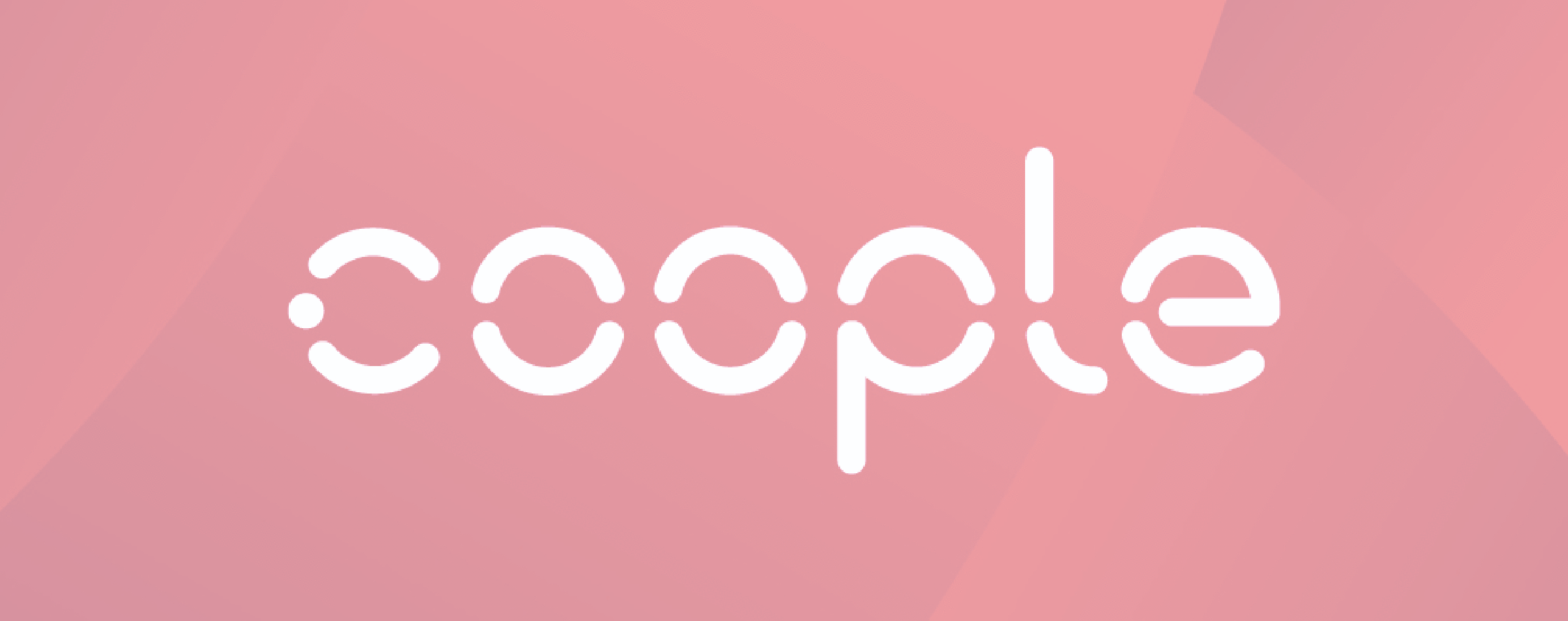Was tue ich hier überhaupt?
Meine Zeit auf Coople ist schon ein Weilchen her, aber trotzdem einen Bericht wert. Kurz vor Ende meines Studiums habe ich meinen Nebenjob im Verkauf gekündigt, da ich keine Fristen abwarten wollte, falls ich direkt eine Stelle finde. Diese Idee führte dazu, dass ich nach Ablauf meiner dreimonatigen Kündigungsfrist drei weitere Monate überbrücken musste. Also musste ein Job her. Aber einer, der nicht mit Verpflichtungen, festen Arbeitszeiten und dem Anmelden freier Tage vier Wochen im Voraus verbunden war. Stichtwort: Bewerbungsgespräche. Ich wollte selber bestimmen, an welchen Tagen ich für meinen zukünftigen Job unterwegs war, und an welchen ich Geld verdienen wollte. Meine Lösung hiess Coople.
Coople ist eine on-demand-Jobplattform. Also eine Art «Uber für Arbeitskräfte». Was hier geteilt wird, ist deine Arbeitszeit. Und zwar zwischen den Firmen, die Jobangebote auf der Plattform veröffentlichen. Einen Arbeitsvertrag hast du mit Coople, nicht mit den Orten, an denen du arbeitest. Also so ähnlich wie ein Temporärbüro, nur dass alles online funktioniert.
Das Administrative
Die Registrierung war relativ schnell erledigt, mit Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse war ich dabei. Danach werden noch Lebensläufe, Zeugnisse und die AHV-Nummer benötigt. Um Jobs vorgeschlagen zu bekommen, konnte ich aus sechs verschiedenen Branchen und etwa 50 Jobprofilen auswählen. Hier merkte ich bereits, dass die Plattform nicht nur Studierende, sondern vor Allem Fachkräfte anspricht. Da ich Erfahrungen im Backwarenverkauf und an der Kasse im Supermarkt hatte, passten aber auch für mich einige Profile.
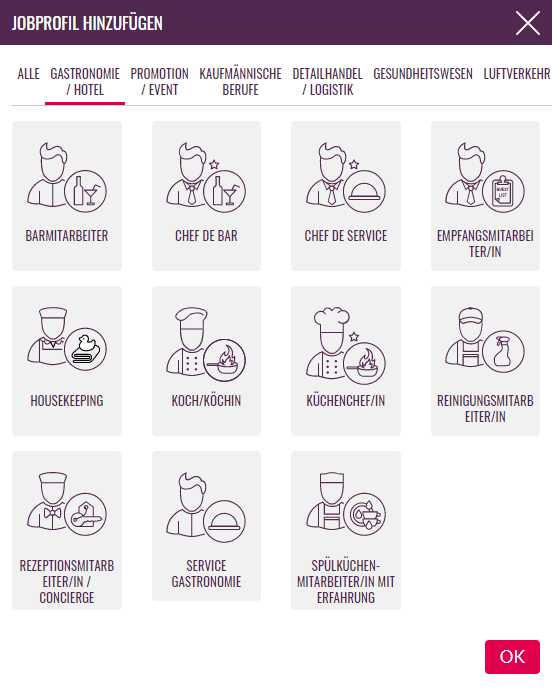
Nach einer Prüfung meiner Daten durch Coople konnte ich loslegen. Für meine Bedürfnisse waren einmalige Einsätze, die nicht länger als 2 Tage dauerten, spannend. Aber ausgeschrieben waren auch Einsätze von bis zu einem Monat. Die Bewerbung auf die Einsätze geht auf der App in unter einer Minute. Nachdem die Bewerbungen verglichen wurden, wird man benachrichtigt, ob man den Einsatz hat.
Der Job
Nach einigen Versuchen hat es dann geklappt. Ein neu eröffneter Glacestand in einem Hotelkomplex war noch auf der Suche nach Verkaufspersonal an Wochenenden. Genau in diesem Job konnte ich mit mehrjähriger Erfahrung punkten und ich bekam den Auftrag für zwei Tage. Je nach Auftrag gibt es Vorschriften, was man mitbringen musste. Dieses Inserat sagte: Schwarze Hose, Oberteil wird zur Verfügung gestellt.
Als ich am Samstagmorgen an meinem Arbeitsort («in der Lobby melden») eingetroffen war, musste zuerst ein Verantwortlicher gefunden werden. Meine Mitarbeiterin für das Wochenende und ich warteten, während herumtelefoniert wurde. Schlussendlich meldete sich ein Koch freiwillig, um uns zu instruieren, bis sich jemand fand, dessen oder deren Aufgabe das war. Spoiler-Alarm: es fand sich niemand, auch in den nächsten Tagen nicht. Der Freiwillige akzeptierte sein Schicksal und war seither der Ansprechpartner für Glaceangelegenheiten.
Die nächste Aufgabe war, das Oberteil aus dem Inserat zu finden. Der neue Verantwortliche war natürlich nicht über das geplante Outfit informiert, war aber schnell und sehr effizient, als es darum ging, eine Lösung zu finden. Wir wurden kurzerhand mit Polos für Angestellte aus dem Spa-Bereich eines der Hotels eingedeckt, die zum Look unserer Umgebung passten. Nach dieser Verzögerung konnten wir den Stand in Betrieb nehmen. Wir legten also, nach einer kurzen Einführung von einem Vertreter des Glaceherstellers, mit dem Verkaufen los. Die Startschwierigkeiten und die Verzögerungen waren anscheinend eingeplant und wir konnten vor dem Ansturm öffnen.

Die Kassensysteme waren langsam, was sich im Laufe des Wochenendes als ungeeignet für einen hektischen Sommertag erweisen würde. Wir wichen auf Strichlisten aus, die wir dann in ruhigeren Momenten in die Kasse übertragen konnten. Improvisation pur, passend zu unserem Start.
Wir merkten schnell, dass uns die Gastro-Mitarbeitenden als Ihresgleichen akzeptiert hatten. In ihren Pausen machten sie Abstecher zu unserem Stand, blieben kurz stehen, wenn keine Gäste in Sicht waren und wir tauschten Tipps und Erfahrungen gegen «Probierportionen» in der Grösse von regulären Glaces aus. Wir kamen auch in den Genuss von Überproduktionen aus der fünf Sterne Küche, in der sie arbeiteten.
Am zweiten Wochenende, zu dem ich mich spontan am Mittwoch davor bewarb, gab ich die Instruktionen für die Neuen. Ich fühlte mich nicht ganz so überfordert wie die anderen, was dazu führte, dass ich plötzlich eine Art Führungsposition innehatte. Zusätzlich zum festen Stand wurde an dem Wochenende noch ein zweiter mobiler Wagen aufgebaut. Dieser hatte kein Kassensystem, sondern funktionierte ganz offiziell über eine Strichliste. Die beiden anderen Aushilfen überliessen mir die Einsatzplanung, wir rotierten zwischen den beiden Ständen und unseren Pausen hin und her, alles lief relativ reibungslos. Vor allem beim Vorbereiten und Aufräumen hatte ich an allen vier Tagen Zeit, um mich mit meinen Mitarbeitenden zu unterhalten.
Gründe für on-demand-Jobs
Meine Mitarbeiterin vom ersten Samstag hatte bereits in Restaurants in der Umgebung im Service gejobbt, ebenfalls über Coople vermittelt. Sie wurde ohne Erfahrung eingestellt. Trotzdem wurde von ihr erwartet, dass sie dieselbe Leistung bringt wie ihre Mitarbeitenden mit Lehrabschluss. Deshalb jetzt der Verkaufsstand. Das brachte mich auf die Frage, weshalb sie auf Coople im Gastrobereich unterwegs sei. Sie erklärte, dass sie unter der Woche in einer Bank arbeitet, wo sie auch ihre Lehre abgeschlossen habe. Da sie sich an den Wochenenden oft gelangweilt habe, sei sie auf die Idee gekommen, sich Nebenjobs zu suchen. Sie mochte die Arbeit und konnte neue Erfahrungen sammeln und neue Menschen kennen lernen. Und dafür bezahlt werden.
Die zweite Mitarbeiterin, die ich Tags darauf traf, weil die Nebenjobberin andere Pläne für den Sonntag hatte, war in einem Zwischensemester nach einem Aufenthalt in England. Für sie hiess es: Führerschein machen. Und diesen irgendwie finanzieren. Sie war, wie ich, Studentin mit wenig Berufserfahrung und wollte sich nicht langfristig binden. Nach diesem Sommer ging ihr Studium weiter. Vielleicht wolle sie nebenbei weiterhin arbeiten, aber sie sei noch nicht sicher. «Das seh› ich dann wenn es soweit ist.»
Am zweiten Wochenende lernte ich noch eine Familienmutter kennen, die langsam den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben angehen wollte. Für sie waren die Wochenenden, an denen ihr Mann auf die Kinder aufpasste, eine Zwischenlösung.
Das Fazit
Nach zwei Wochenenden hatte ich genug. Nicht vom Job, sondern von der leeren Rede von «wir haben die Stelle ausgeschrieben, nächste Woche kommen Sommeraushilfen, die wir unter Vertrag nehmen». Der Job war noch den halben Sommer auf Coople. Aber immer erst Mitte Woche. Mit einem Koch hatte ich, als bei uns beiden wenig lief, ein längeres Gespräch über seine Arbeit und das Phänomen dieser Ultrakurzeinsätze. Er erzählte, dass es viele Wechsel und kurzfristige Anstellungen in dem Hotelkomplex und den dazugehörigen Restaurants gab. Viele Coopler. Und viele Stellen werden vermutlich erst ausgeschrieben, wenn die Hotels an ihre Belastungsgrenzen kämen. Auch die Arbeitgeber wollen sich offensichtlich nicht festlegen und keine langfristigen Bindungen eingehen. Das war in der Branche schon immer so. Skiorte und Feriendestinationen, Saisonarbeit. Plattformen wie Coople machen die ganze Sache einfach noch spontaner. Und Leute wie ich, die weder Kontakte zum, noch Ahnung vom Gastronomiegewerbe haben, erhalten auf Knopfdruck Zugang zu diesen Stellen.
Was ich davon halten soll, weiss ich bis heute nicht. Führt die Plattform in diesem speziellen Fall dazu, dass Arbeitende gezwungen sind, zwischen mehreren Arbeitsorten zu wechseln, und dabei nie zu wissen, ob sie in der nächsten Woche ein Einkommen haben werden oder nicht? Oder ist es eher eine win-win-Situation, bei der sich weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer verpflichten müssen? Oder ändert sich einfach die Art der Vermittlung von offline zu online?
Jedenfalls jobbte ich danach nur noch an Events. Beispielsweise an Verpflegungsständen im Fussballstadion. Dort war immer ein bunter Mix aus Leuten anzutreffen. Einige von ihnen machten diese Aufträge «schon immer» und wurden Stundenweise von der zuständigen Cateringfirma geschickt. Sie hatten sogar ihre Stammkunden, die zum Plaudern blieben. Aber sie alle waren entweder in einem traditionellen Arbeitsverhältnis an anderen Orten angestellt, oder Studierende, die sich etwas dazuverdienten. Da es hier keine festen Verträge gab, geschahen unsere Einsätze auch nicht auf Kosten von Festanstellungen. Damit konnte ich leben.
Coople als Plattform empfand ich als unkompliziert und gut strukturiert. Ich musste mir in allen Einsätzen keine Sorgen um die AHV oder meine Steuererklärung machen. Das erledigte die Plattform für mich. Auch die Arbeitgeber müssen sich nicht um Verträge für alle Arbeitenden kümmern. Sie bezahlen, die Coopler arbeiten. Fertig. Coople zahlte immer pünktlich, bei Fragen war der Kundendienst gut erreichbar. So unkompliziert wie das Anmelden für Jobs. Im folgenden Januar bekam ich meinen Lohnausweis, auf dem die Gesamtheit meiner Stunden zusammengefasst war. Keine Administration für mich.
Keine Telefonate, keine Bewerbungsdossiers. Auch konnte ich auf Bewerbungsprozesse verzichten. Und auf das Abonnieren von Newslettern und das Durchblättern von Stellenanzeigen, nur um dann zu erfahren, dass es bei dem ausgeschriebenen Job keinen Lohn sondern nur eine Provision gibt. Es ist alles von Anfang an klar, bevor ich mich beworben habe wusste ich, wann ich wo sein musste, wie lange ich arbeite und was ich pro Stunde verdiene. Und ich konnte mich in der gesparten Zeit auf meine langfristige Stellensuche konzentrieren. Für mich funktionierte das System. Was die Arbeitgeber damit machen und welche Auswirkungen diese Entwicklung hat, ist eine andere Frage, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten kann.